Die Art und Weise wie sich jemand selbst wahrnimmt, an welchen Normen er sich orientiert und wie er sich in die Gesellschaft einordnet, Identität also, ist der zentrale Faktor der Lebensführung und der sozialen Integration.
Eigen-Sinn
Die neue Mittelklasse der Hochqualifizierten setzt in der derzeitigen Epoche der Spätmoderne die Wertmaßstäbe der Lebensführung. Selbstverwirklichung gilt ihr als absolute Leitnorm. Dabei geht der Blick zunächst nach außen in die Gesellschaft. Dort gilt es Leistung zu erbringen, wirtschaftlichen und sozialen Erfolg zu erringen und sich vor anderen als glückliches und einzigartiges Subjekt darzustellen.
Einseitige Ausrichtung auf den gesellschaftlichen Status ist jedoch häufig mit zwei Konsequenzen verbunden: erstens mit sog. „Burn-out“ (emotionaler Erschöpfung, Gefühlen der Überforderung sowie verminderter Berufs- und Lebenszufriedenheit); zweitens mit der Erfahrung, etwas verpasst und die eigenen Potentiale und Vorlieben nicht gelebt zu haben.
Reflexionskunst setzt deshalb auf ein eigenes und sinnhaftes Wertesystem, in dem materielle, soziale, gesundheitliche und ideelle Ziele gleichberechtigt integriert sind. Leben ist „Uraufführung“ und keine Generalprobe für das „wahre Dasein“ in der Zukunft. Nur diese Zeit – hier und jetzt – und dieses Leben steht uns aktiv zur Verfügung. Also sollten wir es nutzen, um es an unseren Wünsche und Visionen zu orientieren. Selbstkreierte persönliche Bilder helfen, das dazu nötige Selbstvertrauen zu entwickeln.
Nachahmung dabei ist Selbstmord, denn sie blockiert die individuelle Kreativität. Man kann andere zwar zu kopieren versuchen, aber dabei wird man selbst keine eigenen und neuen Entdeckungen machen und sich immer nur in einer Aufholjagd befinden.
Der große jüdische Theologe Martin Buber erzählte einmal die Geschichte von Rabbi Zosya, dessen unkonventionelles Verhalten manchmal Anlass zur Kritik gab. Befreundete Rabbis nahmen ihn ins Gebet und meinten, es reiche völlig, dem Gesetz Moses und den Traditionen zu folgen. Zyosa hörte ihnen aufmerksam zu und erwiderte dann betrübt: “Aber wenn ich meinem Gott im Himmel gegenübertrete, wird er mich nicht fragen: ‚Warum warst du nicht Moses?’, sondern‚ ‚Warum warst du nicht Zyosa?’“


Glaubwürdigkeit
Das Verlangen nach Authentizität ist Teil des normativen Modells der Spätmoderne und ergänzt den Leitwert des Statusstrebens im Interesse einer vollwertigen Selbstverwirklichung.
Authentizität bedeutet „echt“ oder „stimmig“ zu leben und sich maximal am eigenen „wahren“ Selbst mit seinen Wünschen, Wertvorstellungen und Emotionen zu orientieren. Nicht austauschbar zu sein, ganz in seinen Talenten aufzugehen, einen idealen Partner zu haben, einen einmaligen persönlichen Lebensstil zu pflegen und ein individuelles Charisma auszustrahlen machen Lebensqualität in diesem Sinne aus.
In Verbindung mit der Statusnorm ergibt ein kategorischer Wunsch nach Authentizität eine hochambitionierte, in sich widersprüchliche und damit stresserzeugende Zielausrichtung.
Reflexionskunst favorisiert deshalb ein Wertesystem, das auf Glaubwürdigkeit und vorhandenen Begabungen aufbaut, statt sich an narzisstisch überhöhten Idealvorstellungen zu versuchen.
Verantwortung
Die Figuren im Tischfußball haben keine Verantwortung, sie werden vollständig von außen gelenkt. Der menschliche Akteur in einem Fußballspiel hingegen kann Einfluss nehmen. Wer den Ball kontrolliert, verfügt über Chancen und trägt Risiken. Die einen suchen den Ball, halten ihn fest und lenken das Geschehen. Andere vermeiden ihn oder geben ihn so schnell wie möglich wieder ab. Die Identität der jeweiligen Spielerin, zu der auch ihr Können zählt, bestimmt letztlich, ob und wie sie Verantwortung übernimmt. Dazu gehört auch das Verhalten gegenüber der Mannschaft außerhalb des Spielfeldes. Narzisstische Starallüren und kameradschaftliches Teamverhalten – der Profifußball liefert Anschauungsunterricht für beides. Im Hinblick auf Verantwortung kann man folgende Unterscheidungen treffen:
1. Verantwortung für sich selbst, d.h. Orientierung am wohlverstandenen Eigeninteresse statt an
momentanen Neigungen oder egozentrischen Wünschen
2. Verantwortung für nahestehende Personen wie Lebenspartner, Familienangehörige, Freunde
3. Verantwortung für das große Ganze (Gesellschaft, Natur)
Reflexionskunst macht die Chancen und die Anforderungen bewusst, die mit den einzelnen Dimensionen von Verantwortung verbunden sind.


Rollenvielfalt
Zum Identitätskonzept der neuen Mittelklasse gehört eine starke Festlegung auf den erreichten sozio-ökonomischen Status und ein möglichst langes Festhalten an der damit verbundenen beruflichen Rolle. Der Promibereich liefert Anschauungsmaterial hierzu: Greise Politiker, die nicht von der Macht lassen können; populäre Schauspieler, die von der Bühne getragen werden müssen. Der Privatsektor kennt die pensionierte Lehrerin, die das Belehren nicht lassen kann. Der 80-jährige Unternehmer, für den eine Nachfolgeregleung nicht in Betracht kommt etc.
Die bedingungslose Verknüpfung von beruflicher Rolle und persönlicher Identität ist ein Mißerfolgsrezept erster Ordnung für die Lebensführung. Sie geht auf Kosten der außerberuflichen Lebensbereiche während der mittleren Lebensphase und sie blockiert die effektive Beschäftigung mit dem Eintriit in das späte Erwachsenenalter.
Reflexionskunst verhindert, dass sich der erfolgreiche Komiker selbst zur Witzfigur degradiert.
Emotionale Stärke
Selbstverwirklichung stellt primär auf positive Emotionen ab. Sie sind der Prüfstein, an dem die Lebensqualität gemessen wird. Entscheidend ist demnach, wie sich Erfahrungen und die einzelnen Momente des Lebens anfühlen.
Angenehme Gefühle höchster Intensität sind das Ideal. Vorzugsweise sollten alle Lebensbereiche positive Gefühlsempfindungen hervorrufen.
Die beschriebenen normativen Paradigmen der Selbstverwirklichung, der Authentiziät, der Rollenfixierung, der Egozentrik und der Gefühlszentriertheit führen im großen Maßstab und mit größter Wahrscheinlichkeit zu subjektiver Enttäuschung. Fachleute sprechen deshalb bereits von „Toxischer Positivität“.
Weil „Good Vibes Only“ ein Ding der Unmöglichkeit sind, ist die Pflege der eigenen Kompetenz im Umgang mit allen Gefühlen ein wesentliches Element der Reflexionskunst.

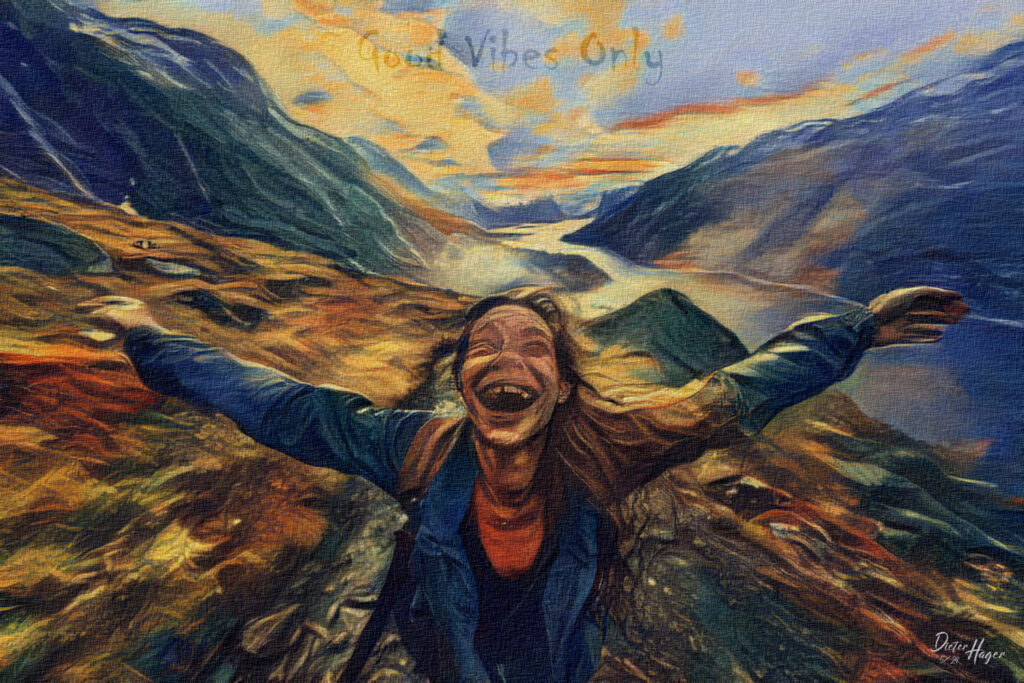
Reale versus virtuelle Lebenswelt
Das Internet und insbesondere die sozialen Medien sind in hohem Maß allgegenwärtige Vergleichstechnologien, die die Enttäuschungeffekte der Selbstverwirklichungskultur noch weiter forcieren. Wer jedoch im „zweiten Leben“ der virtuellen Wirklichkeit Erfüllung zu finden vermagen, ist für die scheinbar bodenständige Reflexionskunst vermutlich nicht mehr zu erreichen.
Bleibt als Empfehlung, einen Blick in den 1932 erschienenen dystopischen Roman „Schöne neue Welt“ von Aldous Huxley zu werfen. Darin sind Kunst und Literatur durch das „Fühlkino“ ersetzt, in dem auch körperliche Empfindungen auf den Zuschauer durch haptische Technologie übertragen werden. Die Handlungen sind seicht und schablonenhaft auf Action und Erotik getrimmt. Aufgrund der intellektuellen und emotionalen Verkümmerung fehlt den Menschen ohnehin der Horizont für gehobene Stoffe.
Das Fühlkino existiert zwar noch nicht, aber die Game Designer der Computerspiel-Industrie und die KI-Spezialisten arbeiten hart daran.